Bewusstes Gestalten unserer Gärten
Das eigene Gartenprojekt kann eine Möglichkeit bilden, die Mensch-Natur-Verbindung neu zu begreifen und zu erleben. Gleichzeitig schafft es einen Raum, um uns bewusst für die Artenvielfalt und das Bewahren alter Kultursorten einzusetzen. Denn beim Anlegen, Hegen und Pflegen eines Gartens wird deutlich: Es handelt sich um eine jahrtausendealte und facettenreiche Beziehung. Selbst Erfahrene können dadurch immer wieder neue Inspirationen und Denkanstöße finden, um auch in Zukunft möglichst ganzheitlich vorzugehen und den Lebensraum Garten bewusst zu erfahren.
Melanie Alessandra Moog
Jeder Garten ist so individuell wie die Menschen, die ihn pflegen. Unsere Bedürfnisse und Vorstellungen hinterlassen ihren Fingerabdruck in unserer Umgebung.
Doch allzu oft zeugt die sogenannte Kulturlandschaft von der anthropozentrischen Idee, dass wir uns die Natur möglichst passend machen wollen, statt zu verstehen, wie wir zu einem Gleichgewicht beitragen können. Die Natur nicht nur als Ressource der Erholung oder des Ertrags zu betrachten, sondern als komplexes System sollte Ziel eines nachhaltigen Gartenprojektes sein.
Den Garten mit allen Sinnen genießen
Auf einem Streifzug durch den Lebensraum Garten gelangen wir in eine Welt fernab von Hektik, Verschmutzung und anderen Problemen der modernen Welt. Wie ein kleiner Garten Eden, ein Paradies, das mancher Mensch verloren und auf Erden unmöglich glaubt, tut sich vor unseren Augen ein Idyll auf, das mit etwas Achtsamkeit alle Sinne anzusprechen vermag: Der lebendige Garten will ertastet, gerochen, betrachtet, gehört und geschmeckt werden. Er pulsiert in kräftigen Farben unter dem Summen der Insekten und den Flügelschlägen der Vögel und Schmetterlinge, riecht nach den unterschiedlichsten Blumen, aromatischen Kräutern und gesundem Mutterboden. Das multisensorische Erlebnis Garten lebt von Vielfalt und hat auch seinen ästhetischen Reiz. Es ist ein Ort der Gestaltung, denn Gärten sind „gezähmte“ Natur, von uns Menschen seit Jahrtausenden angelegt, genutzt, gepflegt und gehegt.
Das Selbstversorger-Gen
Selbst ein kleiner Garten kann ein einmaliger Platz der Erholung sein oder auch auf geringer Fläche einiges an Ertrag in Sachen Früchte und Gemüse für Hobbygärtner bieten. Den Garten achtsam wahrnehmen, uns im geschützten Außenbereich erholen oder uns an der frischen Luft im Garten zu betätigen, im direkten Kontakt mit dem Lebendigen, spricht viele von uns intuitiv an und liegt mehr oder minder in unseren Genen. Denn seit der Sesshaftwerdung, die vor 12.000 Jahren am fruchtbaren Halbmond und vor zirka 5.000 Jahren in Mitteleuropa begann, übten wir uns darin, einen grünen Daumen zu entwickeln, um die Ernährung von Mensch und Vieh zu sichern, zu erleichtern und zu verbessern.
Heutzutage erfreut sich die Selbstversorgung mit gesunden, nachhaltigen und frischen Erzeugnissen aus dem Garten wieder großer Beliebtheit und die ganzheitliche Erfahrung der Mensch-Natur-Beziehung hat auch in wissenschaftlichen Disziplinen wie der Öko-Psychosomatik das Interesse geweckt. Daneben drängt sich noch ein weiteres Thema auf: Der Verlust alter und seltener Sorten rückt immer mehr in den Fokus. Im eigenen Garten können wir einen Beitrag zum Bewahren der wertvollen Saatgutvielfalt leisten.
Ursprung unserer Gärten
Möhren, Kohlsorten, Lein und Hanf waren nur ein paar der beliebtesten Sorten unserer Vorfahren, wenn wir auf die Anfänge des Gartenbaus zurückblicken. Sie stammen von wilden Sorten ab, die nach und nach einen Platz auf dem Speiseplan und neben dem Wohnhaus bekamen. Auch Heilpflanzen wurden hochgeschätzt und nah an der Siedlung vermehrt, um bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können.
Der Garten hat eine lange und spannende Geschichte. Wie das lateinische Wort für Garten, hortus, stammen Begriffe wie garden (englisch), jardin (französisch) und trädgård (schwedisch) von der gemeinsamen indogermanischen Wurzel *gher („fassen“, „umfassen“) ab, was sich später zu ghortus entwickelte. Der Name spielt auf die Umzäunung mit Gerten oder Ruten aus Weide an, wie man es noch heute in manchen rustikalen Bauerngärten sehen kann. Auch der niederländische Begriff tuin spielt auf den Zaun an, der den Garten eingrenzt. Er soll ihn vor Wildschweinen und Dieben schützen. Genauso bezieht sich die germanische Bezeichnung für Garten, haga („Hecke“; „hegen“) auf die Hecke als Umzäunung des Grundstücks.
Hagedorn, Hagebuchen und Hagerosen wurden dafür gern als Begrenzung gepflanzt und tragen diese Verwendung nach wie vor im Namen. Neben der schützenden Funktion können Hecken, Mauern und Zäune aus Naturmaterial bestimmten Tieren ökologische Nischen bieten und gelten daher auch als wertvolle Lebensräume. Den Gartenpflanzen dienen sie als Schattenspender und Rankhilfe.
Neue Mitbewohner und alte Bekannte
Bodenuntersuchungen, aber auch die Volksnamen von Pflanzen können Hinweise darauf geben, woher bestimmte Nutzkulturen stammen, wofür sie verwendet wurden und wie sie sich verbreitet haben. Umfassende Untersuchungen tragen zur Nachverfolgung solcher Wanderungen bei, die den Handel mit oder die Verbreitung von Pflanzen und Samen ermöglichten.
Hierzu forschte im 19. Jahrhundert erstmals Victor Hehn mithilfe linguistischer Studien. Im selben Jahrhundert begann Oswald Heer damit, bei einer Ausgrabung von Pfahlsiedlungen am Bodensee Pflanzenteile zu untersuchen und dadurch botanische wie anthropologische Erkenntnisse zu gewinnen.
Viele unserer europäischen Nutzpflanzen sind in Vergessenheit geraten. Gänsedisteln, die heute als Unkraut gelten, wurden noch im Mittelalter als nährstoffreiche Nahrungsquelle mit leckerem Kohlgeschmack angebaut. Manche ergiebige Bodendecker, wie die Vogelmiere, sind Archäophyten, die schon in der Steinzeit als Nahrungsmittel dienten und sogar noch unter der Schneedecke frisch und grün bleiben – wertvolle Kost besonders in der Winterzeit.
Karotten wurden aus der wilden Möhre gezüchtet, und die Ahnen einiger Salatvariationen sind die Gemeine Wegwarte beziehungsweise der Lattich. Andere Gartenpflanzen, die wir heute kennen und anbauen, stammen ursprünglich aus entlegenen Gegenden der Erde, wie beispielsweise vom fruchtbaren Halbmond oder aus Südwestasien.
Noch heute ist im Rheinland der Weinanbau an Hängen oder auf Terrassen landschafts- wie kulturprägend, nachdem die Weinbaukultur einst von den Römern mitgebracht wurde. Pfirsich- und Feigenbäume kamen dank der Römer ebenso in weite Teile Europas und gedeihen seither auch im milden Rheintal. Einen großen Siegeszug unter den römischen Auswanderern starteten mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Basilikum, Thymian und Salbei. Sie sind aus unseren Gärten und Küchen heute nicht mehr wegzudenken.
Einige andere Lieblinge kamen aus Südamerika, zum Beispiel Tomaten, Kartoffeln, Kürbisse und Mais. Diese haben wir selbstständig weitergezüchtet und veredelt, wodurch sich die Sortenvielfalt enorm vervielfältigt hat.
Wilde und vergessene Sorten wiederentdecken
Heute sind knackige Minigurken, Pflücksalate und leuchtend rote Tomaten aus dem Garten nicht mehr wegzudenken. Sie sind nicht nur perfekt zum Naschen und begeistern auch Kinder, sondern bilden zudem einen Hingucker mit ihrer Form- und Farbenpracht. Neben dem englischen Rasen und üppigen Blumenstauden bilden sie eine ideale Ergänzung, um unser Bedürfnis nach „Grünzeug“ und nachhaltiger Naturerfahrung zumindest im Ansatz zu stillen.
Doch viele naturverbundene Menschen möchten einen Schritt weiter gehen. Nicht nur exotische Variationen oder das Standard-Repertoire aus dem Baumarkt sollen einen Platz im Garten finden, sondern vor allem samenfeste Bio-Sorten, die einen kulturhistorischen Wert, einen besonders intensiven Geschmack und auch einen ökologischen Nutzen haben.
Heimische bunte Wildblumen und vom Aussterben bedrohte Heil- und Würzkräuter finden so einen Platz auf der Wiese und erfreuen unter anderem die Insektenwelt, während im Gemüsegarten vergessene schmackhafte Sorten ein Revival erleben, die man im Supermarkt überhaupt nicht kaufen kann.
Saatgutbörsen bieten eine Möglichkeit, einen Beitrag zum Erhalt der Sortenvielfalt zu leisten und originelle Elemente in den Grünraum zu integrieren. Wir sind nicht in erster Linie Besitzer, sondern Hüter unserer Gärten. Sie sind nicht abgeschnitten von der Umwelt, sondern bilden trotz Gartenzaun und Hecke einen Teil des umgebenden Naturraums. Sie erzählen eine lange Geschichte als einzigartiger, menschengeformter Ort, an dem sich wilde Kraft, ästhetische Gestaltung, nachhaltige Ideale und praktische Nutzung treffen und in Einklang kommen können.
Was ist mit „samenfest“ gemeint?
Samenfeste Sorten sind Pflanzen, die ihre Eigenschaften durch Züchtung nicht verlieren. Ihre Samen können für die nächste Aussaat verwendet werden. Dies ermöglicht es, eigenes an den lokalen Standort angepasstes Saatgut aus den Samen der am besten gedeihten Pflanzen zu züchten.
Der Anbau benötigt größere Aufmerksamkeit bei geringerem Gesamtertrag im Vergleich der zum Anbau mit Hybriden nur einmal verwendbaren Saatkörnern. Für die Selbstversorgung reicht es aus.
Es folgt eine Anzeige unserer Unterstützer*innen/in eigener Sache.
Werbung in der Bonner Umweltzeitung? Unsere Mediadaten
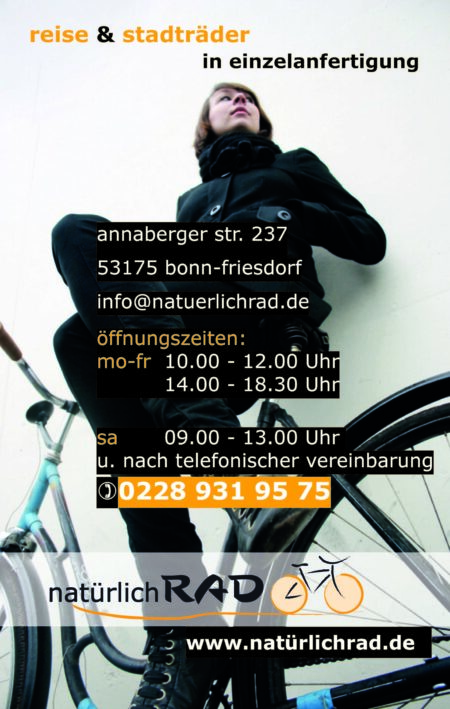













0 Kommentare