Das geplante Seilbahnprojekt in Bonn bietet für die Verbesserung des ÖPNV-Angebots in Bonn zahlreiche Vorteile. Aus Sicht unseres Aktionsbündnisses „Seilbahn für Bonn: JA!“ nennen wir hier nur die wichtigsten fünf Positivaspekte und bitten Sie mit Frage 1 um Ihre jeweiligen Einschätzungen zu den Aspekten A, B, C, D und E:
A) Die Seilbahntrasse sorgt für eine kostengünstige weitere Rheinquerung und schafft kürzest möglich den Geländesprung auf den Venusberg: Das kann kein anderes Verkehrsmittel.
B) Sie entlastet den überlasteten Knotenpunkt Hauptbahnhof/Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB).
C) Sie sorgt für einen weiteren Netzausbau zwischen links- und rechtsrheinischem ÖPNV mit kurzen Umsteigezeiten („Stetigförderer“) und damit für eine deutlich schnellere Verbindung der rechtsrheinischen Pendler zu ihren Bonner Arbeitsplätzen. Die fünf rheinparallel verlaufenden Schienenstrecken werden gut bis sehr gut miteinander verknüpft, so dass auch Aus- und Einpendler profitieren.
D) Die Seilbahn als innovatives, staufreies Verkehrsmittel stärkt das Netz von Bus und Bahn und fördert das Umsteigen auf den ÖPNV, so dass der Straßenverkehr, insbesondere auch zum Uniklinikum, deutlich verringert werden kann. So kann mehr Platz im öffentlichen Straßenraum für Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, Wirtschaftsverkehr und notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen geschaffen werden.
E) Die UN-Klimahauptstadt Bonn zeigt sich als innovative Stadt mit fortschrittlichen Lösungen. Bonn hat deutschlandweit die beste Trasse für eine erste urbane Seilbahn.
Die konkreten Fragen und alle Antworten:
1. Wie bewerten Sie diese Positivaspekte A, B, C, D und E der Seilbahn: Stimmen Sie zu?
Gegebenenfalls: Welche aus Ihrer Sicht sinnvollen Alternativen sehen Sie?
Katja Dörner, Grüne:
Ich stimme den Positivaspekten vollumfänglich zu. Gleichzeitig fehlen noch einige wichtige Aspekte: Die Seilbahn ist eine völlig neue Verbindung, die mit keinem anderen Verkehrsmittel möglich wäre. Gleichzeitig ist sie besonders umwelt- und stadtschonend. Schließlich müssen keine Häuser abgerissen werden wie für den Autobahnausbau oder im großen Stil Grünflächen versiegelt werden. Dabei ist sie auch deutlich günstiger als der Bau einer Straßen- oder Bahnverbindung auf der gleichen Strecke und kostet die Bundesstadt Bonn dank umfangreicher Förderung verhältnismäßig wenig Geld.
Guido Déus, CDU:
Die genannten Aspekte A–E beschreiben ein wünschenswertes Zielbild, das ich persönlich unterstütze: Eine Seilbahn, die staufrei, emissionsarm und effizient eine zusätzlich Verbindung zwischen anderer Rheinseite und bis auf den Venusberg hinauf schafft, könnte einen innovativen Beitrag zum ÖPNV in Bonn leisten, vorhandene Arbeitsplatzschwerpunkte miteinander gut verbinden und ebenso ein touristisches zusätzliche Hightlight sein.
Allerdings sehe ich auch Schwachpunkte in der vorliegenden Planung, wie beispielsweise die teils fehlende Erreichbarkeit mit dem KfZ bzw. eine komplett fehlende Park&Ride- Abstellanlage am Einstiegs-/Endpunkt auf der Beueler Seite, die gerade Berufspendler zum Umstieg verleiten könnten. Die positiven Effekte, die wir von dieser Verbindung erwarten müssen zudem noch weiter nachgewiesen und unabhängig geprüft werden. Wirtschaftlichkeit, verkehrliche Wirkung und städtebauliche Auswirkungen – etwa der große Bahnhof am Loki-Schmidt-Platz – müssen transparent und nachvollziehbar dargelegt werden. Erst wenn fundierte Daten unsere Erwartungshaltung stützen, können wir letztendlich eine belastbare abschließende Entscheidung treffen. Wir erwarten, dass die Verwaltung uns Vorlagen erarbeitet, die die Thesen bestätigen, damit einer positiven Entscheidung zu diesem innovativen Projekt nichts im Wege steht.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Ich stehe zu dem Projekt Seilbahn. Als nachhaltiges Verkehrsmittel ergänzt sie durch die Rheinquerung das Bonner ÖPNV-Netz sinnvoll, entlastet die Verkehrsströme zum Universitätsklinikum auf dem Venusberg und verkürzt die Pendelzeiten. Insbesondere die Vorteile unter A (Geländesprung auf den Venusberg) und C (bessere Verbindung für rechtsrheinische Pendlerinnen und Pendler) sind mit herkömmlichen Verkehrsträgern in dieser Form kaum erreichbar. Die Seilbahn bietet eine innovative Lösung, um den topografischen Herausforderungen in Bonn zu begegnen. Sie ist schnell, zuverlässig und kommt ohne zusätzlichen Flächenverbrauch auf der Straße aus. Auch die Argumente unter B, D und E bewerte ich als zutreffend. Die Entlastung des überlasteten Zentralen Omnibusbahnhofs, die Förderung des Umstiegs auf den öffentlichen Nahverkehr sowie das Signal, dass Bonn eine moderne und klimabewusste Stadt ist, sprechen klar für dieses Projekt. Mir ist wichtig zu betonen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine grundlegenden Änderungen mehr geben sollte, die ein neues Planfeststellungsverfahren erfordern würden. Eine solche Änderung würde die Umsetzung um viele Jahre verzögern. Das müssen wir im Sinne einer erfolgreichen Verkehrswende vermeiden.
Petra Nöhring, FDP:
Die FDP befürwortet den Bau der Seilbahn von der rechten Rheinseite zum Venusberg. Diese kann ein wichtiges Element im ÖPNV-Angebot werden. Daher bewerten wir sämtliche Punkte positiv. Daneben erwarten wir durch die Seilbahn auch einen positiven Effekt für den Tourismus, da für Besucher der Stadt die Fahrt über den Rhein mit Blick auf das Siebengebirge attraktiv sein wird.
Dr. Michael Faber, Linke:
Zunächst möchte ich betonen, dass ich die Fragen zur Seilbahn als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt aus meiner persönlichen Sicht beantworte. In meiner Partei Die Linke Bonn existieren unterschiedliche Positionen zur möglichen Seilbahn. Erst wenn die tatsächlichen Planungsgrundlagen und Kosten hinreichend klar und konkretisiert sind, wird es zu einer abschließenden Positionsbestimmung unseres Kreisverbands kommen. Zu A bis E: Eine besonders „kostengünstige“ Rheinquerung scheint mir die Seilbahn mit sicherlich deutlich über 100 Mio. Baukosten nicht zu sein, die Betriebskosten kommen schließlich noch hinzu. Für Teile des Stadtgebietes und bei Bahnnutzung aus dem Umland würden sich beim bisher angedachten Betrieb sicherlich Fahrzeitvorteile ergeben, die durch andere klimaschonende Verkehre nicht vergleichbar zu erreichen sind. Dies wäre unbestritten ein Vorteil der Seilbahn, den ich ausdrücklich anerkenne. Für mich ist die Frage aber weitergehend entscheidend, ob die Existenz der Seilbahn viele Pendler*innen, die heute noch nicht mit dem ÖPNV unterwegs sind, dann zu einem Umstieg motivieren kann. Hier bin ich skeptisch, auch mit Blick auf die Anbindung der Seilbahn an Sammelparkplätze. Demgegenüber stehen die Kosten, der Landschaftseingriff, eine mindestens sehr langwierige Realisierung und auch eine zu erwartende Nutzung der Seilbahn vorrangig in Kernzeiten morgens und nachmittags. Ob vorlaufender und dann bei Betrieb entstehender laufender Aufwand durch die Effekte für eine von mir unterstützte Verkehrswende im Verhältnis stehen und etwa auch gegenüber Alternativen wie der Anbindung des Venusbergs über eine direkte (Schnell-)Busverbindung vom Haltepunkt UNCampus zum Venusberg überwiegen, stelle ich in Frage. In gewissem Umfang würde die Seilbahn den Knotenpunkt Hauptbahnhof sicherlich entlasten, vor allem anreisende Bahnnutzer*innen, die direkt auf den Venusberg (Klinikum) wollen, könnten den Umstieg am Hauptbahnhof eher vermeiden. Eine relevante Reduzierung des Autoverkehrs auf und vom Venusberg erfordert aus meiner Sicht vor allem aber weitere beschränkende Maßnahmen. Der im Zuge des Ausbaus des Klinikums geplante Kreiselausbau für die Zufahrt auf den Venusberg wird hier aber gegenläufige Tendenzen befördern. Inwieweit sich bei einer tatsächlichen Realisierung der Seilbahn in zehn Jahren weitere Fahrbeziehungen verändert haben, lässt sich kaum vorhersagen. Ob die Bonner Trasse deutschlandweit die beste für eine urbane Seilbahn ist, wage ich nicht zu beurteilen. Für mich überwiegen derzeit die Bedenken gegenüber dem Vorhaben.
Johannes Schott, BBB:
Ihren Ausführungen kann ich nicht zustimmen. Ob die Seilbahntrasse tatsächlich eine „kostengünstige“ Rheinquerung darstellt, ist bislang nicht nachgewiesen. Uns liegt zumindest seitens der Oberbürgermeisterin keine „Spitzrechnung“ der tatsächlich zu erwartenden Kosten vor. Abgesehen davon bezweifle ich, dass die Seilbahn zu einer nennenswerten Entlastung führen wird. Möglicherweise wird sich lediglich der ÖPNV von den Buslinien auf die Seilbahn verlagern. Es stellt sich die Frage, ob die Seilbahn Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV bietet. Mir wäre nicht bekannt, dass an den Haltepunkten P&R-Parkplätze entstehen sollen. Nutzer werden entweder die angrenzenden Wohngebiete zuparken oder gleich mit dem Auto in Richtung Universitätsklinikum (UKB) weiterfahren. Es gibt auch noch kein Konzept für einen attraktiven und schnellen Umstieg vom MIV auf die Seilbahn. Für Trassenbauten und Rettungswege werden massive Eingriffe in Landschaftsschutzgebiete und unwiederbringliche Zerstörungen städtischer Waldflächen in Kauf genommen. Der Seilbahnbau ist dementsprechend nicht automatisch ein Beitrag für den Klimaschutz. Die Auswirkungen auf die von der Trasse betroffenen Anwohner (insbesondere in Kessenich) wurden bisher nicht abschließend geklärt.
2. Vor dem Hintergrund der genannten Punkte sowie weiterer Aspekte: Welchen Stellenwert hat das Seilbahnprojekt für Sie?
Katja Dörner, Grüne:
Die Seilbahn hat unter den Infrastrukturprojekten hohe Priorität für mich. Wir sind in den vergangenen Jahren sehr gut mit dem Projekt vorangekommen. Es sind nur noch wenige Schritte, bis wir das Genehmigungsverfahren für den Bau einleiten können. Das Gute an einer Seilbahn: Der Bau verläuft vergleichsweise schnell. Sobald wir eine Baugenehmigung erhalten, dauert es also nur eine kurze Zeit, bis wir alle endlich mit der Seilbahn über Bonn schweben können.
Guido Déus, CDU:
Die Seilbahn ist eines von mehreren Projekten, die das Ziel verfolgen, den Bonner ÖPNV zu verbessern, hat für uns aber einen besonderen Stellenwert, da sämtliche Alternativen, die eine Verbesserung der Verkehrssituation für den Venusberg und das UKB, als einem der größten Arbeitgeber Bonns, erreichen könnten inzwischen verworfen wurden. Ihr Stellenwert hängt aber entscheidend im Weiteren auch davon ab, wie gut sie sich in das Gesamtverkehrskonzept integrieren lässt – und wie tragfähig Wirtschaftlichkeit, Nutzen und Akzeptanz sind. Gerade deshalb würden wir eine Verbesserung der Umstiegmöglichkeiten vom KfZ auf die Seilbahn als sehr wichtig erachten.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Die Seilbahn hat für mich einen hohen verkehrspolitischen Stellenwert. Sie ist eines der zentralen Infrastrukturprojekte zur Mobilitätswende in Bonn. Die Seilbahn entlastet stark belastete Strecken wie den Venusberg-Korridor, schafft eine neue Rheinquerung und verbessert die Verbindung zwischen links- und rechtsrheinischen Stadtteilen. Zusätzlich fördert sie den Anreiseweg für zahlreiche Arbeitnehmende sowie Konferenzteilnehmende im Bundesviertel. Sie ist damit ein zukunftsweisender Bestandteil eines leistungsfähigen und nachhaltigen Mobilitätssystems.
Petra Nöhring, FDP:
Das Seilbahnprojekt hat eine hohe Priorität. Wir hoffen auf eine Fertigstellung in dem Zeitraum bis zur nächsten Kommunalwahl (2030).
Dr. Michael Faber, Linke:
Ich stehe dem Seilbahnprojekt skeptisch gegenüber und denke aktuell, dass die hohen Kosten und personellen Aufwände (trotz Förderung) an anderer Stelle unserer Stadt besser investiert wären.
Johannes Schott, BBB:
Hier zitiere ich aus dem BBB-Wahlprogramm: „Der Ratsbeschluss zum Bau einer Seilbahn von Ramersdorf über das Regierungsviertel bis auf den Venusberg gründet sich auf die „Standardisierte Bewertung“. Das Verfahren zur Beurteilung von Verkehrswegeinvestitionen im ÖPNV geht für die Bonner Seilbahn jedoch von unrealistisch hohen Fahrgastzahlen aus. Tatsächlich dürfte die Nutzung der Seilbahn begrenzt sein und sich auf die Stoßzeiten konzentrieren. Damit wird die Seilbahn unwirtschaftlich. Überdies ist die Finanzierung des heute rd. 100 Mio. € (66,2 Mio. € im Preisstand 2019, Angabe jeweils netto) teuren Infrastrukturvorhaben nicht gesichert. Die städtische Annahme, 95 % der Kosten würden gefördert, unterstellt eine längst nicht feststehende Zustimmung der EU und eine Landesförderung von 20 %. Ferner verbraucht der ganzjährige Betrieb der Seilbahn 4.498.625 kWh und verursacht im Vergleich zum Auto- und Busverkehr zusätzliche CO2-Emissionen von 240 Tonnen pro Jahr. Zudem ist der Bedarf für einen Seilbahnhalt auf dem Loki-Schmid-Platz nicht ersichtlich. Die vorliegende Planung ist daher mit Blick auf Finanzierung, Umweltverträglichkeit und Störpotenzial für Betroffene als nicht unterstützungswürdig anzusehen.“
3. Soll der ÖPNV in Bonn massiv verbessert werden, und welche Projekte – einschließlich der Seilbahn – sind dabei für Sie in welcher Reihenfolge prioritär?
Katja Dörner, Grüne:
Bonn plant aktuell so viele Nahverkehrsprojekte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Neben der Seilbahn sind das zum Beispiel der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB), das aktualisierte Stadtbahnkonzept mit einer Taktverdopplung zwischen Bonn und Siegburg oder eine neue Bahnstrecke nach Buschdorf sowie eine in den Bonner Westen. Grundsätzlich sind wir in der Lage, an all diesen Projekten parallel zu arbeiten. Die Seilbahn genießt jedoch besondere Priorität, denn die Planung ist bereits weit fortgeschritten und die Bedeutung für ganz Bonn ist hoch.
Guido Déus, CDU:
Ja – ein leistungsfähiger, moderner ÖPNV ist zentral für Bonns Verkehrspolitik der Zukunft. Unsere Prioritäten lauten:
1. Vollständige Überarbeitung des Liniennetzes mit Fokus auf Pünktlichkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit.
2. Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes für Bonn/Rhein-Sieg (Region mit über 1 Mio. Menschen) aus einem Guss – inkl. Streckenführung ÖPNV – von Universität und Hochschule, dass unseren täglichen Pendlerströmen von rd. 200.000 Menschen gerecht wird.
3. Neuplanung des ZOB als logistisches Rückgrat und Raum für sichere Umsteigebeziehungen.
4. Projekte wie die Westbahn, Seilbahn und eventuell Wassertaxen über den Rhein als innovative und zukunftsweisende ergänzende Bausteine.
Eine Priorisierung einzelner der genannten Projekte ist schwierig, viele Dinge sind gleichgewichtig voranzutreiben und greifen wie Zahnräder ineinander. Ein funktionierender ÖPNV steht aber auf unserer To-do Liste ganz weit oben.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Ja, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Bonn ist dringend erforderlich. Neben der Seilbahn hat für mich vor allem die Westbahn höchste Priorität. Sie ist verkehrlich von regionalstrategischer Bedeutung, vor allem für Pendlerinnen und Pendler aus dem linksrheinischen Umland. Die Seilbahn und die Westbahn ergänzen sich in ihrer Wirkung und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Petra Nöhring, FDP:
Neben der Seilbahn hat die Anbindung des Hardtberg über die Westbahn für uns hohe Priorität. Die Planungen müssen zügig vorangebracht und in absehbarer Zeit umgesetzt werden.
Dr. Michael Faber, Linke:
Ja, der ÖPNV muss deutlich verbessert werden, wobei er im deutschen Städtevergleich so schlecht auch nicht ist – die Unzuverlässigkeit ist das größte Ärgernis, das ist leider nicht auf Bonn beschränkt (DB, Baustellen, Fahrer*innenmangel). Ein weiteres Manko sind die vergleichsweise hohen Kosten für Gelegenheitsfahrten, die abschreckend wirken. Mit dem Tages-Klimaticket für 9,90 (für bis zu 5 Personen) steht auch auf unseren Druck hin zumindest im Bonner Stadtgebiet seit diesem Jahr für Kleingruppen eine attraktive Ticketvariante zur Verfügung. Das kostengünstige Monatssozialticket für 19 Euro muss beibehalten werden. Für mich stehen im Angebot ansonsten die Taktverdichtungen auf den nachgefragten Strecken im Vordergrund, um denjenigen, die jetzt schon den ÖPNV regelmäßig nutzen, einen höheren Komfort bieten zu können, die Verlässlichkeit zu steigern und so Anreize für weiteren Wechsel in den Umweltverbund zu schaffen. Bei der Infrastruktur ist für mich neben einem neuen ZOB vor allem der Ausbau der Schienenstrecken (Buschdorf, Hardtberg, Niederkassel) prioritär, um in bisher nicht oder kaum erschlossenen Stadtgebieten einen verbesserten ÖPNV zu bieten.
Johannes Schott, BBB:
Prioritär ist für mich ein bedarfsgerechtes und pünktliches ÖPNV-Angebot auf Schiene und Straße, dazu zählen auch Sicherheit und Sauberkeit. Davon sind wir in Bonn noch weit entfernt. Die Abbindung der Linie 16 aus Köln kommend am HBF und dafür die Wiedereinführung einer Stadtbahnverbindung zwischen Bad Godesberg und Bonn (ehemals Linie 63) hat ebenso Priorität. Auch Querverbindungen (wie die Linie 634 zwischen UKB und UNCampus) sollten gestärkt werden.
4. Stadtverwaltung und Stadtwerke arbeiten jetzt mit einem Projektsteuerer zusammen: Halten
Sie das und die personelle Ausstattung bei der Seilbahnplanung in Bonn für sinnvoll? Welche
Optimierungs- und Beschleunigungsmöglichkeiten sehen Sie, und werden Sie sich dafür einsetzen?
Katja Dörner, Grüne:
Die Seilbahn ist ein Team-Projekt. Deshalb ist es wichtig, dass alle Zahnräder bestens ineinandergreifen und bisher gelingt das auch. Wir arbeiten an vielen Aufgaben im Projekt parallel und nicht nacheinander. Vor allem setzen wir auf Erkenntnisse aus der Vergangenheit und anderen Projekten. Für die Seilbahn haben wir einen Programmsteuerer engagiert, der von der Inbetriebnahme, über die Gestaltung bis zum Genehmigungsverfahren alle Aspekte zentral steuert und im Blick behält. Das stellt ein koordiniertes Vorgehen mit möglichst wenigen unerwarteten Verzögerungen sicher. Mit diesem Vorgehen habe ich auch den Bau der Beethovenhalle erfolgreich auf Kurs gebracht. Es hat sich in Bonn bewährt.
Guido Déus, CDU:
Ja, die Zusammenarbeit mit einem Projektsteuerer ist sinnvoll und notwendig, um Planungsprozesse zu strukturieren, zu beschleunigen und professionell umzusetzen. Allerdings beobachten wir, dass die Einbindung der politischen Gremien unzureichend ist. Prozesse sind oft zu langwierig, die Kommunikation läuft häufig an der Politik vorbei. Das muss sich ändern, auch, um Vertrauen zu schaffen.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Projektsteuerer ist sinnvoll und notwendig. Jetzt ist es entscheidend, dass wir möglichst schnell von der Planung in die konkrete bauliche Umsetzung kommen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die personelle und organisatorische Ausstattung in der Verwaltung so gestaltet wird, dass keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Eine effiziente Umsetzung braucht klare Strukturen, kurze Entscheidungswege und politischen Rückhalt.
Petra Nöhring, FDP:
Nachdem die Seilbahn für förderfähig erklärt worden ist, müssen die Planungen jetzt zügig abgeschlossen und die Bauleistungen vergeben werden.
Dr. Michael Faber, Linke:
Angesichts des Projektumfangs ist die Einschaltung eines Steuerers wohl nötig, wenngleich andere Beispiele zeigen, dass diese keineswegs immer einen reibungslosen Ablauf garantieren. Aufgrund meiner Skepsis dem Projekt gegenüber kann und will ich derzeit nicht überzeugt dafür werben oder versprechen, dass ich für Beschleunigungsmöglichkeiten stehe.
Johannes Schott, BBB:
Als BBB priorisieren wir die Optimierung und Beschleunigung anderer Maßnahmen beim ÖPNV, siehe Frage 3. Im Übrigen sind die von Ihnen genannten Schritte Geschäft der laufenden Verwaltung und damit gänzlich im Verantwortungsbereich der derzeit amtierenden Oberbürgermeisterin.
5. Der geplante Endhaltepunkt „Ramersdorf-West“ bzw. Schießbergweg wird erst in den 30er Jahren den geplanten Anschluss an die S13 erhalten: Wie soll damit in Bezug auf die Seilbahn umgegangen werden? Halten Sie eine überarbeitete Planung für sinnvoll, um die Seilbahn über den jetzt geplanten Endhaltepunkt hinaus zur Stadtbahnhaltestelle Ramersdorf zu verlängern?
Katja Dörner, Grüne:
Wir haben intensiv untersucht, welche Endhaltestelle den größeren Nutzen für die Allgemeinheit hätte. Das Ergebnis war klar der Schießbergweg und der zukünftige Bahnhaltepunkt Ramersdorf-West an gleicher Stelle. Dass die Bahn die Fertigstellung des Haltepunkts „Ramersdorf-West“ nach hinten schieben möchte, darf aber doch nicht dazu führen, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und einfach die schlechtere Lösung wählen. Ich setze mich deshalb vehement dafür ein, dass der Haltepunkt Ramersdorf-West für die S 13 doch schneller und wie geplant gebaut wird und habe deshalb den Bundesverkehrsminister kontaktiert.
Guido Déus, CDU:
In Beuel ist mit Blick auf Beginn/Endstation der momentanen Planung das wichtigste ein funktionierender Mobilitäts-Hub. Hier sind Anreize zu setzen um gerne, bequem und kostengünstig umsteigen zu können. Mit der Veränderung der Endhaltestelle, so wie sie die Verwaltung aktuell vorgeschlagen hat, und der Aussage diese sei schon immer der bessere Standort gewesen unterstreicht die Verwaltung ihre Inkompetenz. Die aktuelle Endhaltestelle ist ein Ergebnis des Überfahrungsverbots über das Telekom-Gebäude. Grundsätzlich muss bei der Wahl des Endpunkts aber die Anbindung an das Gesamtnetz und die Qualität des Mobilitäts-Hubs in Beuel im Fokus stehen. Einzig in einer Umplanung mit einer Endhaltestelle am U-Bahnhof Ramersdorf und einer Erweiterung des P&R-Platzes mit einer P&R-Hochgarage, nebst Angeboten für Car-Sharing, Elektrolademöglichkeiten und Fahrradverleihsystem sehen wir Möglichkeiten Akzeptanz und Attraktivität zu erhöhen.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Ich sehe derzeit keinen Anlass für eine überarbeitete Planung, die den Planfeststellungsbeschluss gefährden oder zeitlich zurückwerfen würde. Eine Änderung in dieser Phase würde das gesamte Projekt um Jahre verzögern. Ich bin jedoch offen für eine spätere Verlängerung, wenn sie verkehrlich sinnvoll ist und auf Grundlage praktischer Erfahrungen mit dem ersten Bauabschnitt geprüft werden kann.
Petra Nöhring, FDP:
Wichtig für das Seilbahnprojekt ist eine gute Anbindung an das übrige ÖPNV-Netz sowie eine ausreichende Zahl von Park&Ride-Plätzen an dem rechtsrheinischem Endhaltepunkt. Eine Verlängerung an den Endhaltepunkt Ramersdorf wäre aus Sicht der FDP wünschenswert.
Dr. Michael Faber, Linke:
Eine solche Fortführung über den Schießbergweg hinaus zum Haltepunkt Ramersdorf würde nach Auskunft der Verwaltung aufgrund geringen Zusatzgewinns den rechnerischen gesamtwirtschaftlichen Nutzen deutlich verschlechtern und eine mehrjährige Umplanung zur Folge haben. Ich sehe zwar Vorteile der Anbindung an den S-Bahnhof Ramersdorf, aber wenn die Verwaltungsargumente zutreffen, spricht das zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine planerische Verlängerung.
Johannes Schott, BBB:
Der bislang in Ramersdorf geplante Haltepunkt dient überwiegend dem dort ansässigen Telekommunikationsunternehmen. Es mutet ein wenig willkürlich an, wenn die OB einerseits den U-Haltepunkt Ramersdorf zum „Mobilitäts-Hub“ ausbauen will, die Seilbahn aber dort keine Anbindung für Pendler erhalten soll. Und ferner dürfte die Anbindung an eine S13, die lediglich zwischen Beuel und Troisdorf verkehrt, nicht besonders attraktiv sein.
6. Zentraler Umsteigepunkt wird künftig der DB-Haltepunkt „UN-Campus“ sein: Sind Sie hier für eine aufwändigere Lösung mit Rampen direkt von den Bahnsteigen zur Seilbahnstation, um möglichst kurze Umsteigewege zu ermöglichen?
Katja Dörner, Grüne:
Wir sollten auf jeden Fall untersuchen, wo die bisherige Planung noch weiter verbessert werden kann. Auch hierfür haben wir den Programmsteuerer engagiert, der alle Aspekte der Seilbahnplanung im Blick haben wird und diese Stück für Stück optimiert.
Guido Déus, CDU:
Auch hier wird die Politik nicht in die Überlegungen mit einbezogen. Eine gute Erreichbarkeit der Seilbahnstation – auch barrierefrei – ist Grundvoraussetzung für den Erfolg des Projekts. Eine Lösung mit möglichst kurzen, komfortablen Umsteigewegen muss daher geprüft werden. Der Umsteigepunkt ist komplex. Vom großen Gefäß (DB) in kleinere (Seilbahn, Bus) umzusteigen, ist eine planerische Herausforderung. Wird sie nicht gelöst, sinkt die Akzeptanz.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Ja. Der Umstieg am DB-Haltepunkt UN-Campus sollte so bequem und barrierefrei wie möglich gestaltet werden. Wenn eine direkte Rampenverbindung von den Bahnsteigen zur Seilbahnstation realisierbar ist, unterstütze ich eine solche Lösung ausdrücklich. Ein zentraler Mobilitätsknoten muss hohen Anforderungen an Nutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit genügen.
Petra Nöhring, FDP:
Das muss im Rahmen der Detailplanung erörtert werden. Für die FDP sollte dieser Punkt die Planung des Gesamtprojekts nicht in die Länge ziehen. Daher halten wir auch einen kurzen Fußweg vom Bahnhof zur Seilbahn für zumutbar.
Dr. Michael Faber, Linke:
Ungeachtet der grundsätzlichen Frage zur Seilbahn kann ich dies aktuell nicht beurteilen, da für die möglichen Varianten weder genaue Zeitpläne noch Kostenschätzungen vorliegen. Kurze Wegebeziehungen sind natürlich wünschenswert, aber die notwendigen Einigungen mit der DB nicht einfach und die Kosten im Zweifelsfall sehr hoch.
Johannes Schott, BBB:
Um diese Frage seriös und vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten beantworten zu können, müssen zunächst alternative Planungen mit Kostenschätzungen vorgelegt werden.
7. Plädieren Sie für eine weiterhin transparente, bürgerbeteiligende Planung, um Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss möglichst zu vermeiden?
Katja Dörner, Grüne:
Absolut. Ich habe an den großen Bürgerforen in Dottendorf teilgenommen, die einen großen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion beigetragen und einen konstruktiven Austausch sehr befördert haben. Wir tauschen uns weiterhin intensiv mit den Unternehmen und Anwohnenden entlang der Trasse aus und haben in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt. Öffentlichkeitsbeteiligung hat in Bonn eine besondere Bedeutung und bei der Seilbahn haben wir bisher ein besonders großes Angebot gemacht. So werden wir weitermachen.
Guido Déus, CDU:
Ja, unbedingt. Wir machen Politik für die Bürgerinnen und Bürger, also ist es selbstverständlich, dass alle Bürger die Chance haben müssen, den Prozess zu verfolgen und sich einzubringen. Transparenz und Bürgerbeteiligung sind essenziell. Wenn die Seilbahn ein Erfolgsmodell werden soll, müssen sich die Bonnerinnen und Bonner mit dem Projekt identifizieren können. Darüber hinaus ist eine umfassende Beteiligung auch rechtlich wichtig, um Klagerisiken zu minimieren und mangelhafte Planfeststellungsbeschlüsse zu vermeiden.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Ja, ich stehe für eine transparente Planung, die die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbezieht. Ziel ist es, Verständnis für das Projekt zu schaffen und mögliche rechtliche Auseinandersetzungen zu minimieren. Ob nach dem Kölner Urteil noch Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss möglich sind, ist juristisch zu klären. Unabhängig davon ist eine gute Kommunikation das beste Mittel, um Akzeptanz zu fördern.
Petra Nöhring, FDP:
Ja.
Dr. Michael Faber, Linke:
Ich bin mir nicht sicher, ob die noch transparenteste Bürgerbeteiligung etwas daran ändern wird, dass eine oder mehrere Klagen gegen einen Bau der Seilbahn kommen werden. Unabhängig davon ist eine solche Bürgerbeteiligung immer wünschenswert.
Johannes Schott, BBB:
Wir als BBB fordern bei allen Projekten größeren Umfangs eine transparente Bürgerbeteiligung. Diese wird allerdings unter OB Dörner nicht praktiziert und es gibt auch kein Anzeichen dafür, dass sich das ändern könnte unter den bestehenden Mehrheitsverhältnissen. Der BBB fordert bei einem Projekt wie das der Seilbahn einen Ratsbürgerentscheid. Als Oberbürgermeister würde ich die Bürgerinnen und Bürger über die Seilbahn – nach Erstellung einer belastbaren Entscheidungsgrundlage – abstimmen lassen.
8. Wann sollte aus Ihrer Sicht die Seilbahn in Bonn in Betrieb gehen?
Katja Dörner, Grüne:
Ein genaues Datum für die Inbetriebnahme möchte ich noch nicht nennen. Denn mir ist eine seriöse und funktionierende Projektplanung sehr wichtig. Ich rechne damit, dass wir 2027 das Genehmigungsverfahren für den Bau der Seilbahn bei der Bezirksregierung Köln initiieren. Sobald wir die Baugenehmigung erhalten – und ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt – können wir die Seilbahn in kurzer Zeit bauen. Da die Bestandteile der Seilbahn im Werk vorgefertigt werden, ist ein Bau in gerade einmal anderthalb Jahren möglich.
Guido Déus, CDU:
So schnell wie möglich – wenn alle Voraussetzungen seitens der Stadtverwaltung nachgewiesen und erfüllt sind: Wirtschaftlichkeit, Nutzen, Integration ins Netz, Akzeptanz.
Jochen Reeh-Schall, SPD:
Die Seilbahn soll innerhalb der nächsten Ratsperiode gebaut und in Betrieb genommen werden. Das ist ein realistisches Ziel, sofern keine Verzögerungen durch erneute Planungsprozesse entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt an der Umsetzung arbeiten und keine Diskussionen führen, die das Verfahren unnötig verlängern würden.
Petra Nöhring, FDP:
Die Seilbahn ist neben der Westbahn eine wesentliche Investition zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots. Es muss daher seitens der Verwaltung eine hohe Priorität für das Projekt bestehen. Wir hoffen auf eine Inbetriebnahme der Seilbahn bis spätestens 2030.
Dr. Michael Faber, Linke:
Auf Basis der vorhandenen Informationen und meiner jetzigen Einschätzung kann ich hierzu keinen Termin nennen, da ich den Bau nicht befürworte.
Johannes Schott, BBB:
Da wir den Bau der Seilbahn aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse nicht unterstützen, stellt sich diese Frage für mich nicht.
Die Fragen stellte:
Aktionsbündnis Seilbahn für Bonn: Ja!
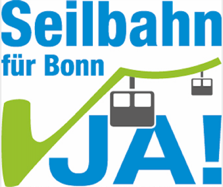














0 Kommentare